Paris-Moskau: Gefährliche Liebschaften


In ihrem im Herbst 2024 erschienenen Buch – „Paris-Moscou. Un siècle d’extrême droite“ – zeichnen Nicolas Lebourg und Olivier Schmitt die Geschichte der Beziehungen der französischen extremen Rechten zur UdSSR und zu Russland nach (…). Ein Rückblick auf gefährliche Liebschaften.
In ihrem Buch zeichnen Nicolas Lebourg und Olivier Schmitt ein ausgesprochen dynamisches, prorussisches Umfeld, das von der extremen Linken über die Republikaner bis hin zur extremen Rechten reicht. Ihm gehören zahlreiche prominente Persönlichkeiten an, darunter viele Absolventen der renommierten Elitehochschule ENA. Einige von ihnen waren bereits in der Vergangenheit in rechtsextremen Gruppierungen aktiv, die eine prorussische Haltung vertraten. Zu diesen Akteuren zählen unter anderem Yvan Blot, Jacques Cheminade, François Asselineau und Paul-Marie Couteaux. Mehrere von ihnen pflegen zudem enge Verbindungen zu Politikern wie dem Abgeordneten Nicolas Dupont-Aignan oder Philippe de Villiers. Letzterer wurde sogar im Jahr 2014 von Wladimir Putin empfangen, um gemeinsam über Projekte wie Freizeitparks oder Hotelanlagen in Russland nach dem Vorbild des französischen Themenparks Puy du Fou zu beraten.
Schon lange vor dem viel beachteten Treffen zwischen Marine Le Pen und Wladimir Putin im Kreml im März 2017 war Jean-Marie Le Pen in Russland aktiv. Bereits 1996 traf er dort auf russische Ultranationalisten wie Sergej Baburin, der ein „Europa der Nationen von Brest bis Wladiwostok“ propagierte. Baburin, damals Abgeordneter und heute Vizepräsident der Duma, unterhielt enge Kontakte zu Radovan Karadžić, der wegen ethnischer Säuberungen in Bosnien zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. 2011 erklärte der Front National Russland zu einem strategischen und privilegierten Partner. Sieben Jahre später erklärte Éric Zemmour, er träume von einem „französischen Putin“ und stellte provokativ die Existenz der Ukraine infrage (2018).
Ideologische Verbindungen und Antiamerikanismus
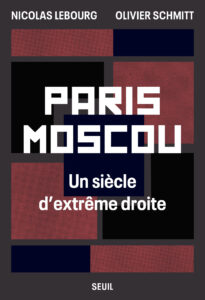
Das Buch stellt die extreme Rechte in den Mittelpunkt, zeigt jedoch gleichzeitig, wie durchlässig die ideologischen Grenzen zu anderen politischen Lagern sind. Derzeit sind insbesondere Übereinstimmungen zwischen den extremen politischen Lagern zu beobachten, die sich sowohl vom autoritären Modell Wladimir Putins als auch vom illiberalen Führungsstil Donald Trumps angezogen fühlen. Lange war es vor allem der Antiamerikanismus, der als gemeinsamer Nenner fungierte und die Annäherung sowohl der extremen Rechten als auch der Linksextremen (und anderer Parteien) an die russischen Positionen erleichterte. So unterstützten etwa Jean-Pierre Chevènement und Jean-Luc Mélenchon während des Irakkriegs (2003) öffentlich die Politik Putins. 2015 stimmte Mélenchon gegen eine Resolution des Europäischen Parlaments, die die Ermordung von Boris Nemzow verurteilte. Alexej Nawalny bezeichnete er als „Rassisten und Antisemiten“ – ein Versuch, Putin zu entlasten. Im November 2017 wurde Chevènement in Moskau mit dem Orden der Freundschaft geehrt – für seine „Bemühungen um Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern“ sowie für seine „aufrichtige und herzliche Haltung gegenüber Russland“. Wladimir Putin dankte ihm persönlich. In Fragen wie Syrien oder der Ukraine folgen viele dieser Akteure der Linie des Kremls.
Politische Verflechtungen und finanzielle Interessen
Diese Strategien können auch finanzielle Interessen widerspiegeln. Ein gutes Beispiel dafür ist die 2004 mit Unterstützung des Konzerns Total gegründete Vereinigung „Französisch-russischer Dialog“. Der als Wirtschaftsforum angepriesene Verein wird gemeinsam von dem RN-Abgeordneten Thierry Mariani und dem ehemaligen Duma-Abgeordneten Walentin Jurjewitsch Katassonow geleitet. Mariani, der als kremlnah gilt, zeigte sich 2014 bei den Feierlichkeiten zur Annexion der Krim an Putins Seite. Die Vereinigung agiert faktisch als Lobbyorganisation für französische Unternehmen mit Russland-Bezug. Auch der ehemalige Premierminister François Fillon bekleidete – wie der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder – Posten in den Vorständen großer russischer Öl- und Gaskonzerne. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine (Februar 2022) sah sich jedoch auch Fillon gezwungen, diese Ämter aufzugeben.

Kulturelle und religiöse Netzwerke als Instrumente
Während das Buch den Fokus auf Politik und die extreme Rechte legt, rücken andere, deutlich sichtbare Aspekte in den Hintergrund – insbesondere die vielfältigen kulturellen und intellektuellen Austauschbeziehungen mit dem heutigen Russland. Die scheinbar „unpolitische“ Welt der Unterhaltung („monde du spectacle“) wird in russischen Medien gezielt inszeniert, etwa bei öffentlichen Auftritten mit Wladimir Putin, und entsprechend den Bedürfnissen des Kremls eingesetzt. Prominente Beispiele dafür sind Mireille Mathieu oder Gérard Depardieu, denen 2013 die russische Staatsbürgerschaft verliehen wurde.
Andere einflussreiche Netzwerke sind religiös geprägt und stehen seit über zwanzig Jahren im Fokus der russischen Machthaber. In Frankreich empfangen Moskauer Kirchen regelmäßig Redner und Wissenschaftler, die die Politik des Kremls unterstützen. Der Bau der russisch-orthodoxen Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit in Paris (2010-2016) ermöglichte es, kremlfreundliche religiöse Netzwerke zu mobilisieren. Das Ziel: die Stärkung einer Form der Einmischungsdiplomatie. In Nizza war die Kathedrale Saint-Nicolas – das meistbesuchte Bauwerk der Stadt und ein symbolischer Ort der russischen Emigration – seit 1930 dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel unterstellt. 2011 übernahm jedoch der russische Staat die Kontrolle über das Gotteshaus, um seine Netzwerke an der Côte d’Azur besser steuern zu können.
Akademische Einflussnahme und intellektuelle Verstrickungen
Auch die slawistische akademische Welt in Frankreich gerät zunehmend ins Visier – insbesondere vor dem Hintergrund der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine ausgelösten Spaltungen. Der Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und bekennender Unterstützer Moskaus, reiste mehrfach nach Russland, um dort Vorträge zu halten – obwohl sämtliche akademischen und wissenschaftlichen Kooperationen mit russischen Institutionen offiziell ausgesetzt worden waren.
Frankreich profitierte lange Zeit von einer aktiven Russophilie. Diese stützte sich auf den mittlerweile rückläufigen Russischunterricht sowie auf die ehemals einflussreichen, heute nahezu verschwundenen kommunistischen Kulturnetzwerke des Landes. Dennoch übt die Vorstellung eines starken, wiedererstarkten russischen Staates weiterhin eine gewisse Faszination aus – nicht nur auf Teile der ehemaligen französischen Sowjetologen, sondern auch auf einen souveränistisch orientierten intellektuellen Rand, sowohl links und rechts. Im Februar 2003, mitten im Tschetschenienkrieg, empfing etwa Hélène Carrère d’Encausse – Russlandexpertin und ständige Sekretärin der Académie française – Wladimir Putin mit allen Ehren. Sie bezeichnete ihn als „Erben Peters des Großen“, da es ihm gelungen sei, „einen echten Staat wiederherzustellen.“
Bei der Linken sehen Intellektuelle wie Michel Onfray oder Emmanuel Todd die Hauptverantwortung für das derzeitige Chaos in der Ukraine bei den USA. Bei der Rechten wiederum beklagt der Philosoph und ehemalige Minister Luc Ferry in Le Figaro (2. März 2022), man habe sich „einen Feind neu erfinden“ können. Er kritisiert Europas Unterstützung für die Ukraine, während er die Verantwortung Wladimir Putins relativiert. Seit 2014 haben solche medienwirksamen Intellektuellen zweifellos Einfluss auf bestimmte Abgeordnete und politische Kreise genommen. Ihre Äußerungen könnten auch wirtschaftspolitische Entscheidungen beeinflusst haben – insbesondere im Hinblick auf die Frage eines Boykotts Russlands.
Medien und russische Propaganda
Das Buch zeigt auch, wie sich russische Propaganda durch die Medien weiterentwickelt hat und seit der Wahl Donald Trumps 2016 zu einer wichtigen Quelle für russischen Einfluss auf globaler Ebene geworden ist. In Frankreich spielte der prorussische Fernsehsender Russia Today (RT) eine zentrale Rolle in dieser Offensive. RT wurde 2005 in Moskau gegründet und vertritt konsequent die Positionen der russischen Regierung. Thierry Mariani, Abgeordneter des RN, war Mitglied des Ethikkomitees des Senders. Nach der Invasion der Ukraine wurde RT in der EU verboten. Die mit der extremen Rechten und verschwörungsideologischen Milieus verbundenen russischen Netzwerke stützen sich nun auf Medienkonzerne wie jene von Vincent Bolloré. Diese tragen maßgeblich dazu bei, neopopulistische Persönlichkeiten zu fördern, die sich gegen die angebliche „westliche Dekadenz“ und einen vermeintlichen „muslimischen Totalitarismus“ wenden.

Russlands Soft Power in Europa
Durch das Prisma der rechtsextremen Netzwerke in Frankreich zeigt das Buch die Auswirkungen dieser neuen illiberalen Soft Power. Obwohl dieses Modell in Europa nur schwerlich Begeisterung finden kann, erhält es dennoch breite Unterstützung von bestimmten politischen und wirtschaftlichen Eliten in Frankreich. Zwar bleiben Europa und seine demokratischen Werte nach wie vor ein bevorzugtes Ziel russischer Propaganda, doch der Aufstieg einer extremen, prorussischen Rechten in enger Allianz mit einem autoritären, repressiven Regime könnte die Situation grundlegend verändern. Diese heterogene extreme Rechte erhält heute nicht nur die Unterstützung Putins, sondern auch Trumps. Beide sind gleichermaßen bemüht, populistische und identitäre Bewegungen in Europa zu stärken, um so die europäischen Demokratien zu destabilisieren und deren Rechtsstaatlichkeit zu verhöhnen.
Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version eines Beitrags, der auf der Online-Plattform unseres Partners Telos unter dem Titel „Les relais Paris-Moscou“ veröffentlicht wurde.
Übersetzung: Norbert Heikamp
Der Autor

Kristian Feigelson ist Professeur des Universités an der Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 und Forscher am IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel). Er unterrichtet Soziologie des Films und der audiovisuellen Medien und ist zugleich als Forscher am INALCO und der EHESS tätig.


