Dominique de Villepin:
Zwischen Medien und Macht


Buch, Partei, Präsidentenambitionen: Dominique de Villepin ist zurück. Ex-Diplomat Hans-Dieter Heumann analysiert für dokdoc das Phänomen.
Warum ist Dominique de Villepin derzeit der beliebteste Politiker in Frankreich? In einer Umfrage der angesehenen Wochenzeitung „Paris Match“ vom Mai dieses Jahres liegt er schon den dritten Monat vor Édouard Philippe, dem früheren Premierminister von Staatspräsident Emmanuel Macron. Angesichts der als polarisiert geltenden öffentlichen Meinung in Frankreich fällt auf, dass de Villepin sowohl bei der Linken, etwa La France insoumise von Jean-Luc Mélenchon, als auch bei den Republikanern, Unterstützung findet. De Villepin will bei den Präsidentschaftswahlen im April 2017 antreten, mit seiner neu gegründeten Partei „La France humaniste“. Die Zeit bis dahin ist noch lang, gerade in der französischen Politik.
Aufstieg aus der Elite
De Villepin ist ein typischer Vertreter der französischen Elite. Deshalb erstaunt seine Popularität, hat man doch die Unzufriedenheit und Proteste in der französischen Bevölkerung immer auch als Aufstand gegen diese Eliten gesehen. Als Absolvent der École nationale d’administration (ENA), der traditionsreichen Kaderschmiede der französischen Elite, schlug er 1980 den Weg zum Quai d’Orsay ein, dem französischen Außenministerium. Dort fiel er schnell durch seine diplomatische Schlagfertigkeit auf. Sein Ziehvater, Präsident Jacques Chirac, berief ihn 1995 zum Generalsekretär des Élysée, also zum Leiter der Präsidialverwaltung – einer Schlüsselposition, die in Deutschland dem Chef des Bundeskanzleramts entspricht und für die politische Steuerung der Regierung entscheidend ist. Es folgte 2002 das Amt des Außenministers und 2005 das des Premierministers. Die Jahre, in denen er Außenminister war, waren eine Blütezeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Dominique de Villepin und der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer haben einiges auf den Weg gebracht, nicht nur die gemeinsame Haltung zum Krieg im Irak, sondern auch in den Dossiers Nuklearabkommen mit dem Iran (JCPoA) und Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zwei Themen, die heute immer noch von großer Aktualität sind. De Villepin und Fischer waren sich zwar freundschaftlich verbunden. Als Persönlichkeiten waren sie aber völlig verschieden: Der eine versuchte, auch in seiner Sprache und Gestik die „Grandeur“ der französischen Nation zu verkörpern, der andere eher zurückhaltend und unbekümmert um diplomatische Formen.
Außenpolitik als Markenzeichen
Eine Erklärung für die Popularität Dominique de Villepins mag darin liegen, dass es angesichts der Umbrüche in der internationalen Politik ein Bedürfnis nach Erklärung gibt und der frühere Außenminister in dieser Rolle glaubwürdig ist. De Villepin ist für viele Franzosen der „große Weise“ (Jean Garrigue), der auch noch viele Bücher geschrieben hat. Er ist in den Medien omnipräsent. Sein Eintreten für die Palästinenser im Gaza-Krieg heute wird ähnlich beachtet wie seine Rede im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Februar 2003. Diese hat ihn weltberühmt gemacht. Die Franzosen lieben den Gestus des Widerstands, mit der er sich damals gegen den Krieg der USA im Irak gestemmt hat. Sehen sie heute eine mögliche Parallele im Umgang von Präsident Donald Trump mit Europa? Mit der Abkehr der USA von Europa in der Handels- und Sicherheitspolitik ist eine Dramatik im transatlantischen Verhältnis erreicht, die das neue Buch von Dominique de Villepin genau zum richtigen Zeitpunkt erscheinen lässt.
Gaullist – „jusqu’au bout des ongles“
„Die Macht, nein zu sagen“ ist mehr als ein politisches Pamphlet, mit der sich de Villepin für die Präsidentschaft empfehlen will. Sein Schwerpunkt ist der sehr interessante außenpolitische Teil mit dem Titel: „den Imperien Widerstand leisten“ (Teil I). Der innenpolitische Teil mit der Aufforderung, „die Republik wiederherstellen“ (Teil II), ist schon eher dem näher rückenden Wahlkampf geschuldet. Migration, Islamismus, Ungleichheit, oder Krise der öffentlichen Dienste stellt de Villepin auch als zivilisatorische Probleme dar („in Erwartung der Barbaren“), denen er soziale Gerechtigkeit und die Stärkung der öffentlichen Ordnung durch verbindliche Regeln und funktionsfähige Institutionen entgegenstellen will. Besondere Aufmerksamkeit sei dem Verständnis de Villepins von der Rolle des Präsidenten der Republik empfohlen. Vor allem hierbei erweist er sich unverhüllt als Gaullist, der das Vorbild mit den Worten zitiert, dass der „Staatschef über den Parteien steht“, die Einheit des französischen Volkes und die „volonté générale“ verkörpert. Der Präsidentschaftskandidat will sich so von Nicolas Sarkozy, François Hollande und Emmanuel Macron absetzen, denen er vorwirft, für die zunehmende Polarisierung der politischen Kräfte in Frankreich verantwortlich zu sein.
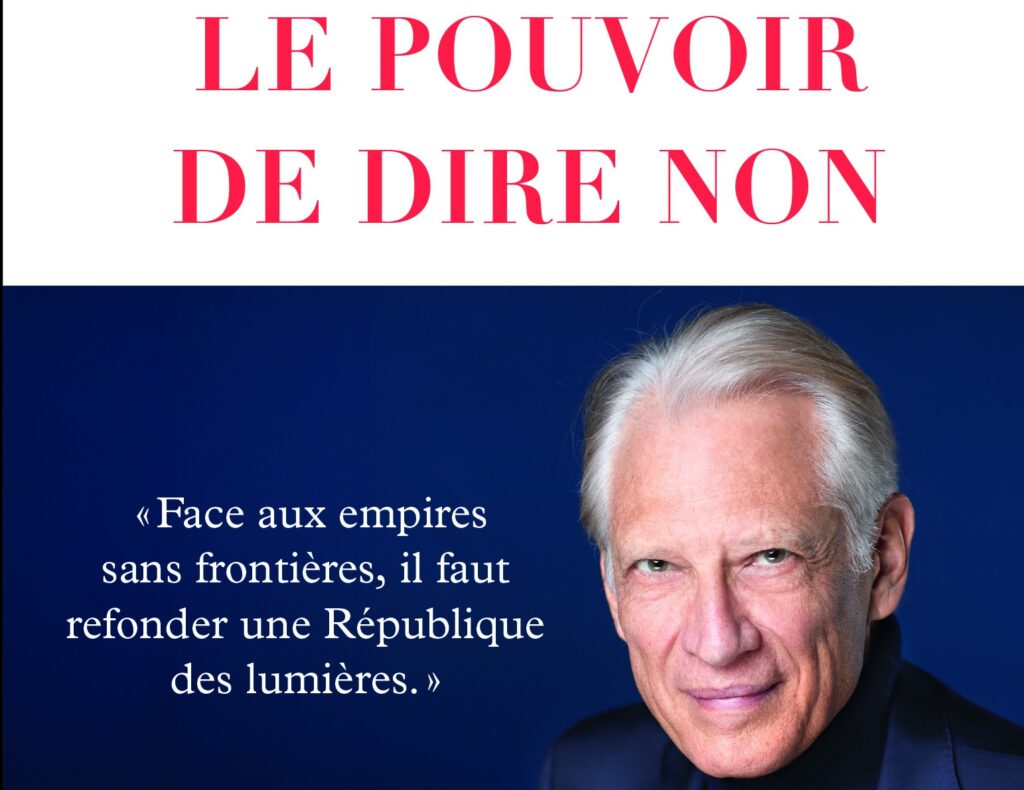
Innovativ ist die Verbindung von Innen- und Außenpolitik, die de Villepin vornimmt. Sowohl bei den populistischen, „illiberalen Bewegungen“ als auch in der internationalen Politik sieht er eine „imperiale Logik“ am Werk. Die Globalisierung selbst habe die Machtpolitik befördert, indem sie den Wettbewerb um Ressourcen verschärfe. Zu den Imperien, denen man sich widersetzen müsse, zählt de Villepin nicht nur China und Russland, sondern auch die USA unter Donald Trump. Dieser sei aber nur das Symptom einer „Krankheit“, die de Villepin als „Erschöpfung der prometheischen Welt“ bezeichnet. Er nimmt hier eine nicht mehr ganz neue Kulturkritik an der Moderne auf, die ungehemmtes Wachstum, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, eine regellose Globalisierung und die zunehmende Bedeutung militärischer Macht als Mittel der Politik aufnimmt.
Globale „imperiale Logik“
Die „imperiale Logik“ wird in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen gezeigt. Der „Absolutismus“ Trumps gründet hiernach weniger auf eine bestimmte Ideologie als auf den „Instinkt“ der Ausübung von Macht. Auch die Zölle sind ein Instrument der Machtpolitik. Die großen Technologie-Firmen der USA, die digitalen Plattformen wiederum gewinnen Macht über das Denken. Trump betrachtet nicht Europa, sondern Putins Russland als Partner, mit dem er von Großmacht zu Großmacht beiderseitige Interessen aushandeln will, auch auf Kosten der territorialen Integrität der Ukraine und der Sicherheit Europas. China sucht Stabilität durch die von der Kommunistischen Partei ausgeübte Kontrolle der Gesellschaft und größtmögliche wirtschaftliche Unabhängigkeit. Staatliche Förderungen vor allem von Zukunftsindustrien sorgen im Wettbewerb mit den USA für den weiteren Aufstieg. Für Russland ist staatliche Kontrolle zu einer Obsession geworden. Der Zusammenbruch der Sowjetunion bewirkte eine Krise der russischen Identität, die Präsident Putin mit einer Rückbesinnung auf die imperiale Tradition des Landes lösen will. Der Revisionismus, die Kriege Putins aber haben Russland geschwächt. Die Repression erstickt die Innovation. Gemeinsam ist den „Imperien“ der Wille, die sogenannte „liberale Ordnung“ aus Regeln und Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, zu zerstören oder gemäß den eigenen Interessen zu formen.
Europa als Gegenmodell zum Neo-Imperialismus
De Villepin kommt hier zur wichtigsten Botschaft seiner Schrift: Europa erhält seinen Sinn, seine Identität dadurch, dass es als „Gegenmodell“ zum aktuellen „Neo-Imperialismus“ dient. Es ist sozusagen „post-imperial“, indem es Machtpolitik durch die Wiederherstellung des Rechts, der Regeln und Institutionen ersetzt. Hierfür muss Europa zur „Europe puissance“ werden, ein Begriff, den de Villepin von Jacques Chirac geborgt hat und der in Vergessenheit geraten war. Europa erklärt und realisiert seine Unabhängigkeit vor allem in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik durch Reduzierung seiner Abhängigkeiten, der Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit und neuer Partnerschaften im globalen Süden sowie durch die Festigung des europäischen Pfeilers der NATO und den weiteren Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie. Vieles davon befindet sich bereits auf einem guten Weg, und de Villepin kann keine völlig neuen Vorschläge vorlegen. Sein Verdienst liegt darin, die Entwicklungen der internationalen Politik präzise zu erfassen und zur richtigen Zeit die entscheidenden Impulse zu setzen.
Der Autor
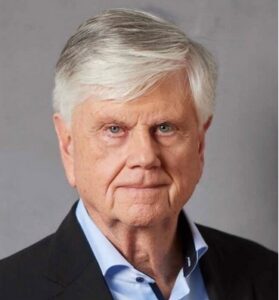
Der ehemalige Botschafter Dr. Hans-Dieter Heumann war Diplomat unter anderem in Washington, Moskau und Paris und bekleidete Leitungsfunktionen im Auswärtigen Amt sowie im Verteidigungsministerium. Bis 2015 leitete er die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin. Heute ist er Associate Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Als „Politischer Gesandter“ der deutschen Botschaft in Paris nahm Heumann an mehreren bilateralen Treffen des damaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer mit seinem französischen Kollegen Dominique de Villepin teil. Seine Erfahrungen sind in diesen Artikel eingeflossen.


