Frankreich im Sattel – eine politische Tour d’Horizon


Was passiert, wenn man sich aufs Rad setzt, um ein Land zu verstehen? Jean-Marie Magro hat es ausprobiert. Er ist 3.000 Kilometer quer durch Frankreich gefahren und hat mit mehr als 100 Menschen gesprochen. Sein Buch Radatouille ist eine politische Tour d’Horizon und ein persönlicher Versuch, sich zwischen Deutschland und Frankreich zu verorten.
Andreas Noll: Jean-Marie, Du bist in München aufgewachsen, hast aber französische Wurzeln. Wann wurde dir klar, dass du diesem Land nicht nur näherkommen, sondern es wirklich verstehen möchtest – und das am besten auf dem Rennrad fahrend?
Jean-Marie Magro: Die Idee meiner Tour de France kam mir schon vor fünf Jahren. Von Anfang an war mir klar, dass ich dieses Abenteuer nur mit „professioneller Begleitung“ in Angriff nehmen könnte. Zum Glück war mein Fahrradmechaniker Peter von dem Gedanken genauso begeistert wie ich und er sagte mir sofort zu: „Wenn du das machst, bin ich dabei!“ Ursprünglich wollten wir einen Film drehen, bei dem es weniger darum ging, Frankreich zu verstehen, sondern eher um die Frage: Kann ein ganz normaler Mensch wie ich, ein ambitionierter Hobbyradfahrer, so eine Tour de France schaffen, diese körperlichen Strapazen durchstehen? Im Laufe der Zeit hat sich der Fokus jedoch verschoben. Lieber wollte ich Frankreich, über das ich als Politikjournalist häufig berichte, porträtieren und seine Vielfalt darstellen.
Noll: In Deinem Buch beschreibst Du ein Land voller Widersprüche – ein Land, das fest an seine Ideale glaubt. Das zieht sich immer wieder durch, und doch stößt man auch oft auf Situationen, in denen diese Ansprüche an Grenzen stoßen. Wenn Du auf Deiner Reise einen Moment der Hoffnung erlebt hast – wo war das?
Magro: Eine schwierige Frage, aber ich möchte es versuchen. Nach 15 Etappen und rund 2000 Kilometern haben Peter und ich bei meinem lieben Freund Daniel in Hochsavoyen übernachtet. Daniel ist etwa doppelt so alt wie ich, war früher ein starker Radfahrer. Wir lernten uns vor Jahren bei einer Alpenüberquerung kennen. Inzwischen ist er nicht mehr so gut in Form, weil er einige gesundheitliche Probleme und Operationen hinter sich hat. Damit wollte er sich jedoch nicht abfinden. Er versuchte sich oft an einem der Berge vor seiner Haustür, doch drehte immer früher um. Vor kurzem aber schaffte er sich ein E-Rennrad an und sagte mir: „Wenn das nächste Mal jemand an dir hinauf zum Galibier vorbeifliegt, bin ich das!“ Er akzeptierte seine Grenzen – und Hilfe – und fand neue Kraft. Vielleicht ist das auch ein Bild für Frankreich: nicht mehr eine „grande puissance“ wie früher, aber mit neuer Rolle, weiterhin mit Einfluss und neuem Mut.
Noll: Auf Deiner Reise durch Frankreich hast Du mit über 100 Menschen gesprochen – und immer wieder drehte sich alles um eine zentrale Frage: Wie geht es eigentlich der französischen Republik? Was ist geblieben vom großen Versprechen, das Frankreich so besonders macht – dem Dreiklang aus Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit?
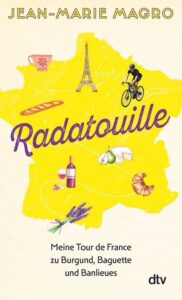
Magro: Auf den ersten Dutzenden Seiten meines Buches beschäftige ich mich vor allem mit dem Thema Égalité. Die Idee der Meritokratie – also der Herrschaft der Verdienstvollen, wenn man so möchte – ist in Frankreich tief verankert. Dahinter steckt die Vorstellung: Unabhängig davon, wie gut der Geldbeutel unserer Eltern gefüllt ist, haben wir alle die gleiche Chance, alles erreichen zu können. Wahrscheinlich traf dieses Versprechen nie zu und heutzutage erst recht nicht, wie mir die Sozialwissenschaftlerin Monique Dagnaud im Interview erklärte. Wer auf die besten weiterführenden Schulen möchte, muss die Spielregeln kennen – und das sind vor allem die Kinder von Lehrerinnen und Lehrern. Man sieht also: Dieses große Versprechen der Égalité – so wohlwollend man auch darauf blicken möchte – wird in der Realität oft nicht eingelöst.
Noll: Aber dieses Versprechen trägst du ja auch in Deinem Buch weiter. Es lebt – trotz aller Widersprüche.
Magro: Ja, es gibt diesen Glauben – gerade bei jemandem wie Stéphanie Motta-Garcia, der Schulleiterin vom Lycée Henri IV in Paris, ist es besonders tief verankert – auch wegen ihrer Biografie. Sie ist in Marseille in einem HLM, also einem Sozialwohnkomplex, aufgewachsen und hat sich dank Bildung ihren Weg nach oben erkämpft. Für sie ist das Ideal der Chancengleichheit kein abstraktes Konzept, sondern gelebte Erfahrung. Gleichzeitig sagt sie sehr klar: Unsere Republik reproduziert Eliten. Diejenigen, die bereits dazu gehören, ziehen oft Kinder groß, die ebenfalls dazugehören werden. Und für jene, die nicht Teil dieser Elite sind, wird es immer schwieriger, den sozialen Aufstieg zu schaffen.
Noll: In Deinem Buch gibt es auch ein starkes Zitat von Deinem Freund, einem jüdischen Filmautoren, den du Ben nennst, der aber eigentlich einen anderen Namen trägt. Er sagt sinngemäß: In der Schule gibt es keine Christen, Jüdinnen oder Muslime, sondern nur Kinder der Republik. Das ist dieses klare, republikanische Versprechen, für das Frankreich so bekannt ist. Und doch: Ben, überzeugter Laizist, schickt seine Kinder wegen Bedenken um ihre Sicherheit auf eine katholische Privatschule. Ist das schon eine Art Kapitulation vor der Realität?
Magro: Ich habe seinen Namen geändert, um ihn zu schützen. Und das aus gutem Grund. Der 7. Oktober hat auch in Frankreich Spuren hinterlassen – besonders in den Schulen. Ben betonte zwar, dass seinen Kindern bislang nichts passiert sei. Aber er habe von so vielen Vorfällen gehört und eine so große Angst entwickelt, dass er sich gezwungen sah, sie in eine katholische Privatschule einzuschreiben. Diese Sorge wird auch von der Sozialwissenschaftlerin Monika Dagnaud bestätigt. Sie sagt: Als Jude überlegt man sich heute sehr genau, ob man sein Kind auf eine öffentliche Schule schickt – besonders, wenn der Anteil muslimischer Schüler dort hoch ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Vorfällen kommt, sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Noll: Wie blicken Deine Gesprächspartner in die Zukunft? Mit welchen Perspektiven rechnen sie in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren?
Magro: Das ist ganz unterschiedlich, aber mir fällt bei vielen eine Grundstimmung auf, die der ehemalige ZEIT-Korrespondent Georg Blume in einem Buch als „Frankreich-Blues“ beschrieb, also eine gewisse Melancholie. Will sagen: das Gefühl, man habe das goldene Zeitalter der französischen Republik erlebt – und jetzt gehe es nur noch bergab. Als Emmanuel Macron 2017 gewählt wurde, hieß es damals noch, die Optimisten hätten sich gegen die Pessimisten durchgesetzt. Doch wenn ich heute zum Beispiel mit Ben, aber auch vielen anderen im Hexagon spreche, spüre ich vor allem eine große Zurückhaltung – bei manchen auch Angst.

Noll: Du hast auf Deiner Tour de France auch religiöse Orte besucht. Frankreich gilt historisch betrachtet als die „älteste Tochter der katholischen Kirche“. Welchen Platz nimmt Religion – insbesondere das Christentum – heute noch in der französischen Gesellschaft ein?
Magro: Ich beobachte keinen merklichen im Alltag, sieht man von den Diskussionen in den Medien von Vincent Bolloré ab. Vielleicht mache ich das an meiner eigenen Familiengeschichte fest: Wenn ich in den Sommerferien in der Provence bei meinen Großeltern war, in unserem kleinen, beschaulichen Ort, lief am Sonntagvormittag entweder der Gottesdienst im Fernsehen – oder wir gingen in die Kirche. Damals hatte das einen festen Platz im Alltag. Heute jedoch hat die Bedeutung der katholischen Kirche im Vergleich dazu deutlich abgenommen. Manche Gemeinden müssen inzwischen Priester aus französischsprachigen afrikanischen Ländern wie dem Senegal locken, weil es schlicht zu wenige französische gibt. Und auch im öffentlichen Leben ist die Rolle der Kirche stark zurückgegangen. Der Historiker Christian Bougeard beschreibt das am Beispiel der Bretagne sehr anschaulich. Er sagt, früher seien die Kirchen eine Art gesellschaftliches Lagerfeuer gewesen. Heute, wo ihre Bedeutung schwindet, entsteht an genau dieser Stelle eine Sollbruchstelle, was politische Kräfte wie der RN für sich nutzen. Jérôme Fourquet, einer der bekanntesten Sozialwissenschaftler Frankreichs, beobachtet dies ebenfalls. Früher, sagt er, stand die Kirche im Zentrum und ein Ort richtete sich an ihr aus. Heute sind es die großen Supermärkte am Ortsrand: Super U, Intermarché und Co., die etwa Kleinstädten ihre Struktur verleihen.
Noll: Gibt es einen Ort, an dem du sagen würdest: Ja, hier habe ich das Frankreich erlebt, das uns vielleicht in zehn, 15 oder 20 Jahren prägen wird?

Magro: Es wird ganz unterschiedliche „Frankreiche“ geben, wenn man so möchte. In Toulouse etwa kann man schon sehr deutlich sehen, wie sich Ballungsräume entwickelt haben und noch werden. Hier, in Okzitanien befinden wir uns relativ weit im Süden, der Anteil von Menschen mit maghrebinischer Einwanderungsgeschichte ist spürbar höher als in großen Teilen des Landes. Was besonders auffällt, ist, wie stark eine Stadt von einem Unternehmen geprägt werden kann – in diesem Fall Airbus. Aber auch das Thema Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle. Denn Place du Capitole aus gingen vor über einem Jahr die Proteste der Landwirte los. Ich habe mit Jérôme Bayle gesprochen, der damals eine Schlüsselrolle spielte. Der Anteil der Grünen-Wähler steigt und bald wird es eine Schnelltrasse für den TGV geben, die die Fahrtzeit zwischen Toulouse und Bordeaux auf eine Stunde verkürzen und Paris damit in knapp drei Stunden erreichbar machen wird. Allein in Toulouse beobachten wir also mehrere Strukturwandel. Das ist ein Teil von Frankreichs Zukunft. Aber die Republik wird unterschiedliche Formen annehmen. Ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass das Thema Zuwanderung in kleineren Orten im Beaujolais, in der Bretagne oder im Baskenland in zehn oder 15 Jahren eine zentrale Rolle spielen wird. Vielmehr wird es weiterhin vor allem die südlichen Städte und Paris betreffen. Eine Konstante jedoch bleibt: Paris wird zweifellos der Magnet bleiben, der alles anzieht – die meisten Unternehmensgründungen, die größte technische und digitale Innovation. Es gibt bestimmte Säulen im französischen System, an denen sich nicht rütteln lässt.
Dieses Gespräch ist eine gekürzte Fassung des Franko-viel-Podcastes „#79 – Frankreich im Sattel – Eine Tour durch Republik und Realität“ vom 19. April 2025.
Unser Gast

Jean-Marie Magro ist in München geboren und Sohn einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters. Er wuchs in der bayerischen Landeshauptstadt auf, studierte Volkswirtschaft und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Er arbeitet als Hörfunkreporter in der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. In Reportagen, Features und Interviews berichtet er vor allem über Themen der Außenpolitik mit besonderem Augenmerk auf Frankreich. Von ihm erschien am 17. April 2025: Radatouille. Meine Tour de France zu Burgund, Baguette und Banlieues (DTV, München).
In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut.




