Neue Bücher:
„Nicht mehr im Frieden“


Das vor wenigen Wochen erschienene Buch des französischen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu ist eine kühle Analyse dieses „tiefen strategischen Bruchs“, der unsere kollektive Sicherheit bedroht. Bruno Tertrais analysiert es für dokdoc.
Es hat Tradition: Französische Politiker schreiben gerne Essays – als Wahlmanifest, als Bilanz ihres Wirkens, als Memoiren oder alles zusammen. Sie verkaufen sich in der Regel schlecht, abgesehen von denen ehemaliger Staatspräsidenten. Man muss zugeben: Inhaltlich sind sie oft uninteressant.
Das von Armeeminister Sébastien Lecornu herausgegebene Buch ist ein etwas ungewöhnliches Werk. Erstens, weil der Minister heute noch im Amt ist: Er ist der dienstälteste Minister der Macronie, der einzige, der seit 2017 allen Regierungen angehörte. Zweitens und vor allem, weil es sowohl ein persönliches Zeugnis als auch ein didaktisches, ja sogar pädagogisches Buch für möglichst viele Menschen sein soll. Lecornu will deutlich machen, dass seine Mitbürger wie auch viele Europäer beunruhigt sind.
Daher der recht gut gewählte Titel: Vers la guerre? wobei das Fragezeichen wichtig ist. Denn Sébastien Lecornu distanziert sich von den einfachen Analysen, die man seit zwei Jahren hier und da aufblühen sieht, die die Ukraine mit Frankreich vergleichen und sich vorstellen, wie unser Land reagieren könnte, wenn es auf dieselbe Weise überfallen würde. Ein absurdes Szenario, das der Minister zu Recht ausschließt. Und doch scheint er von der Idee besessen zu sein, unsere Verteidigung auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorzubereiten. Er sagt, er sei von einer Frage geprägt, die Admiral Philippe de Gaulle am Ende seines Lebens stellte, als er ihn besuchte: „Warum haben wir 1940 verloren?“
Ein neuer Kontext

Sébastien Lecornu ist Gaullist durch und durch. Er bekennt sich offen zu einem großen alten Mann, Pierre Messmer, der wie er den Titel eines Minister „der Streitkräfte“ und nicht „der Verteidigung“ trug. Im Gegensatz zu Messmer leitete er jedoch – zumindest bisher – keine großen, sichtbaren, mit seinem Namen verbundenen Reformen ein. Man muss auch sagen, dass die französische Landesverteidigung seit mehr als drei Jahrzehnten immer wieder reformiert wurde, und dass einige, im Eiltempo durchgeführte Reformen die Institution traumatisiert haben. Dies gilt vor allem für die Revue générale des politiques publiques (Allgemeine Revision der öffentlichen Politik) unter Nicolas Sarkozy, die die Organisation und Logistik der Militärbasen tiefgreifend veränderte.
Der Verteidigungsminister hingegen ist zu Recht besorgt über die notwendige Anpassung der Streitkräfte an den neuen technologischen Kontext, von der Robotisierung über die künstliche Intelligenz und den Weltraum bis hin zur Quantenrechnung. Dies hindert ihn keineswegs daran, die Bedeutung des Fundaments unserer Verteidigungspolitik, der nuklearen Abschreckung, zu betonen. Dabei meint er die Zweitschlagsfähigkeit („arme de ‚non recours‘“), nicht aber den atomaren Erstschlag („arme de ‚non emploi‘“), von dem in Frankreich allzu oft die Rede ist. Und er unterstreicht die Bedeutung der seit 2017 getroffenen Entscheidungen zur Erneuerung und Vorbereitung dieser dritten Generation unserer Atomwaffen.
Diskretion und Treue
Lecornus‘ Stil sind Diskretion und absolute Treue zum Präsidenten der Republik in allem, was er tut. Wie dieser hat er eine rote Linie: den Primat der Politik und den absoluten Gehorsam der Truppe. So zögert er nicht, wie er in seinem Buch erzählt, die Generalstäbe zum Umdenken aufzufordern, wenn er meint, sie schenkten der Weltraumverteidigung nicht die nötige Aufmerksamkeit.
Auch wenn das Buch natürlich – wie könnte es anders sein? – eine Rechtfertigungsübung sein soll für das eigene Handeln und das des Präsidenten, so überzeugt die Erklärung bestimmter Entscheidungen nicht immer. Dies gilt beispielsweise für die Entscheidung, kein neues Weißbuch zur Verteidigung und nationalen Sicherheit vorzulegen, was man zu Beginn einer jeden neuen Amtszeit eines Staatspräsidenten erwartet (das ist übrigens bei unseren Verbündeten so üblich). Ein solches Unterfangen hat den Vorteil, dass alle Akteure an einen Tisch gebracht werden. Weder bei der Strategischen Überprüfung von 2017, die nur das Armeeministerium betraf, noch der Überprüfung von 2022, einer reinen Verwaltungsreform, fand das statt.
Der Minister vergisst nicht die von nichtstaatlichen Akteuren ausgehenden Bedrohungen und widmet der zunehmenden Vernetzung dschihadistischer Gruppen, dem „Netz der Proxies“ des Iran und natürlich den russischen Milizen, die sich mit Frankreich in Afrika anlegen, recht interessante Seiten. Auf diesem Kontinent, so der Minister, dürfe unser Land nicht mehr „der einzige Sicherheitsanbieter sein, der gleichzeitig seinen Konkurrenten freie Hand lässt, dort ihren Geschäften nachzugehen“. Schnell geht er jedoch über die akzeptierte, aber erzwungene Wende hinweg, als ein Großteil unserer Streitkräfte aus Ländern abgezogen wurde, in denen sie lange Zeit präsent waren…
Und Europa?
Man mag bedauern, dass das Buch nicht mehr Überlegungen zu künftigen Krisen anstellt, die von nicht verbündeten Ländern ausgelöst werden könnten oder… durch künftige Entscheidungen Amerikas. Dem Indopazifik wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, bis auf die französischen Überseegebiete, die der Minister gut kennt. China stellt offensichtlich keine direkte militärische Bedrohung für Frankreich dar: Der zunehmende Aktivismus Pekings in allen Sicherheitsbereichen, von der Spionage auf hoher See bis hin zur Vernetzung von Infrastrukturen, wird aber in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine Herausforderung für ganz Europa darstellen. Da hätte man sich gewünscht, der Minister hätte das stärker akzentuiert. Es versteht sich von selbst, dass ein hypothetischer Konflikt um Taiwan große unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf unseren gesamten Kontinent hätte. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Und ganz allgemein: Welche Rolle müssen und können die Europäer übernehmen, wenn sich die Bedingungen für ihre kollektive Verteidigung ändern, insbesondere wenn Washington seine strategischen Prioritäten abrupt ändern sollte? Diese politisch heikle Baustelle wird kaum angegangen.
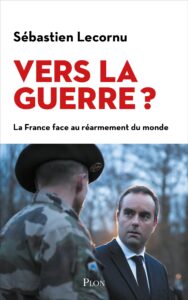
Im Übrigen finden sich in diesem Buch recht wenige neue Vorschläge. Das war zugegebenermaßen auch nicht seine Aufgabe. Es werden dennoch einige Perspektiven aufgezeigt, wie zum Beispiel die der sogenannten „patriotischen Finanzen“: Der Minister möchte, dass zusätzlich zum Staatshaushalt weitere Ressourcen für die Wiederaufrüstung eingesetzt werden können.
Kriegstüchtig sein
Die von Sébastien Lecornu vorgelegte Bilanz ist in Wahrheit erst eine Zwischenbilanz, und man kann darauf wetten, dass sich der Armeeminister in der neuen französischen Regierungsmannschaft umso wohler fühlt, als, wie er fein bemerkt, „kein Inhaber des Amtes [des Premierministers] jemals seine verfassungsmäßigen Kompetenzen voll ausgeschöpft hat“.
Wir – die Europäer – befinden uns nicht im Krieg, aber „auch nicht mehr im Frieden“. Mit diesem hybriden, für die Öffentlichkeit nicht immer leicht zu akzeptierenden Zustand sehen wir uns konfrontiert. Sébastien Lecornus Plädoyer zielt darauf ab, besser verständlich zu machen, warum und wie Frankreich versucht, sich dieser neuen Lage zu stellen. Denn wenn es auch nicht an „vorderster Front“ der Kämpfe im Osten Europas steht, muss es sich doch wehren gegen Desinformation, Cyberangriffe und Terrorismus. Dieses präzise und gut recherchierte, aber dennoch leicht zu lesende kleine Buch ist inhaltlich reichhaltiger als drei Viertel der von anderen Politikern veröffentlichten Werke.
Der Autor
Bruno Tertrais ist stellvertretender Direktor der Fondation pour la recherche stratégique, dem führenden französischen Think Tank für internationale Sicherheitsfragen. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und promovierte bei Pierre Hassner. Nach seiner Tätigkeit bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO arbeitete er im Verteidigungsministerium und bei der RAND Corporation. Er trat 2001 der FRS bei. Tertrais war zudem Mitglied der Kommissionen für das Weißbuch zur Verteidigung und nationalen Sicherheit in den Jahren 2007-2008 und 2012-2013. Er veröffentlichte kürzlich „La Guerre des mondes: Le retour de la géopolitique et le choc des empires“ (Paris, L’Observatoire, 2023).


