„Die Zeit ist gekommen für ein nukleares Aachen“


Donald Trump ist zurück im Weißen Haus, Friedrich Merz könnte bald Kanzler sein – und plötzlich ist die Frage einer europäischen nuklearen Abschreckung durch die Force de frappe keine abstrakte Debatte mehr.
Andreas Noll: „Deutschland wird nicht selbst über Atomwaffen verfügen können und dürfen und dabei wird es auch bleiben. Aber nukleare Teilhabe mit Frankreich, mit Großbritannien ist aus meiner Sicht jedenfalls ein Thema, über das wir reden müssen“, sagte Friedrich Merz, der womöglich nächste Kanzler in einem Interview vor wenigen Tagen. Herr Lübkemeier, solche Worte hat man bislang nicht von Regierungspolitikern gehört. Was könnte diese Ankündigung für Deutschland und die Bundeswehr bedeuten?
Eckhard Lübkemeier: Solche Worte hat man tatsächlich noch nicht gehört. Es war längst überfällig. Das Angebot, das Emmanuel Macron vor über vier Jahren machte, die europäische Dimension der Force de frappe zu stärken, hätten wir schon damals annehmen sollen. Nun ist es aber so: Wir müssen nun nach Alternativen suchen, für den militärischen und vor allem nuklearen Schutz, den uns die USA in den letzten 75 Jahren gewährten. Dieser Schutz droht in rasanter Geschwindigkeit zu erodieren. Hier muss sich Deutschland fragen, welche Alternativen es hat, falls dieser Schutz vollständig wegfällt. Und wenn man nicht eine deutsche Bombe will, die man ohnehin kurzfristig nicht entwickeln könnte, dann bleibt eigentlich nur Frankreich als möglicher Ersatz dafür.
Noll: Bei den zahlreichen Drohungen des US-Präsidenten und seiner Administration in Richtung Europa war aber bislang nicht von einem Rückzug des amerikanischen nuklearen Schutzschirms die Rede. Und dennoch sagen Sie: Es ist jetzt schon notwendig, für einen Ersatz zu sorgen…
Lübkemeier: Sie haben recht, explizit wurde damit nicht gedroht. Aber dass Friedrich Merz jetzt das Gespräch mit Emmanuel Macron und übrigens auch mit London suchen will, das kommt ja nicht von ungefähr. Die Trump-Administration hat massive Zweifel gestreut an ihrer Verlässlichkeit.
Noll: Seit 2020 hat Emmanuel Macron wiederholt die Erweiterung des französischen nuklearen Schutzschirms ins Gespräch gebracht bzw. eine strategische Debatte darüber gefordert. In einer Fernsehansprache am 5. März sagte der Präsident, er wolle „die Debatte über den Schutz unserer Verbündeten durch unsere Abschreckung“ eröffnen. Wir hatten in unserer Atomfolge vor genau einem Jahr viel über über vertrauliche Gespräche hinter den Kulissen diskutiert. Jetzt ist aber nichts mehr mit vertraulichen Gesprächen hinter den Kulissen – da wird vielmehr ein deutliches Signal in der Öffentlichkeit gezogen. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Lübkemeier: Ich will es mal etwas bildhaft formulieren. Die Zeit ist gekommen für ein „nukleares Aachen“. Deutschland und Frankreich haben im Aachener Vertrag erklärt, dass ihre Sicherheit untrennbar sei. Der Vertrag enthält zudem im Artikel 4 eine verbindliche Beistandsklausel für den Fall, dass einer der beiden Staaten angegriffen wird: In diesem soll der andere Staat alle in seiner Macht stehenden Mittel einsetzen, um ihm zu Hilfe zu kommen. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, diese Beistandsklausel explizit auch auf die französischen Nuklearstreitkräfte zu beziehen.
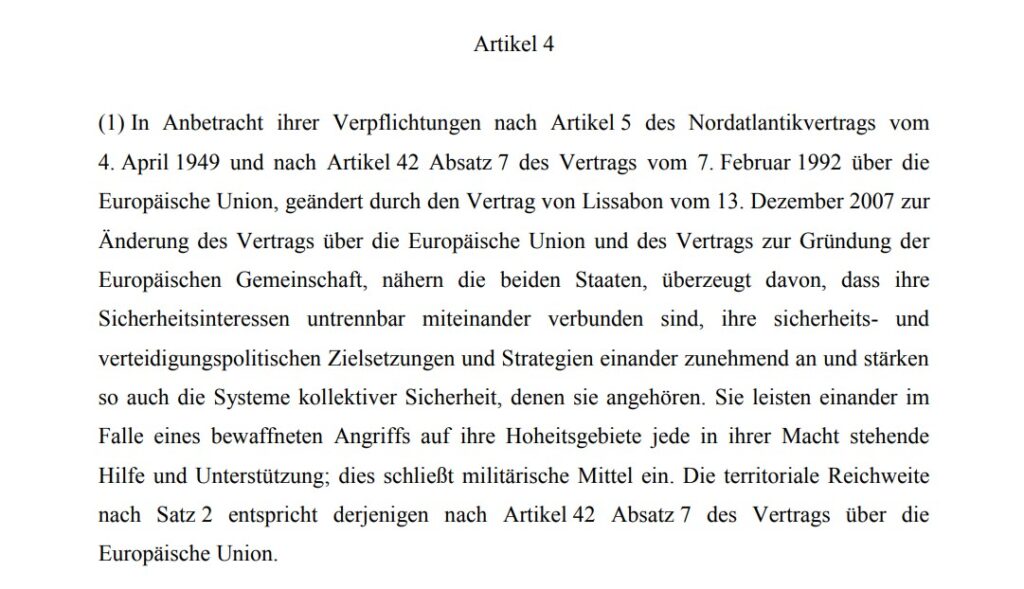
Noll: Was würde das konkret bedeuten?
Lübkemeier: Beide Seiten müssten dann erklären: Zu den militärischen Mitteln, mit denen man sich gegenseitig Beistand versprochen hat, gehören auch die französischen Nuklearstreitkräfte. Implizit war das vielleicht immer gemeint. Aber wenn man das jetzt durch eine gegenseitige Präzisierung ausdrücklich machen würde, dann wäre so gesehen auf der deklaratorischen Ebene Deutschland von jetzt auf gleich unter dem französischen Atomschirm.
Noll: Wäre dafür eine Neuverhandlung des Aachener Vertrages notwendig?
Lübkemeier: Es bedarf keiner Neuverhandlung, sondern einer klaren Bestätigung, dass die französischen Nuklearstreitkräfte zu den in Artikel 4 der Beistandsklausel genannten militärischen Mitteln gehören. Wenn man das machen würde, wäre von jetzt auf gleich eindeutig, dass die Force de frappe nicht nur Frankreich schützen soll, sondern eben auch den Partner, nämlich die Bundesrepublik Deutschland.
Noll: Aber haben nicht alle Präsidenten seit Charles de Gaulle gesagt, dass Deutschland bzw. auch die Benelux-Länder immer mitgemeint sind?
Lübkemeier: Ja, stimmt. Es ist immer mal wieder die Rede davon gewesen, dass die Abschreckungsreichweite der französischen Nuklearstreitkräfte sich nicht auf das französische Sanktuarium beschränkt. Das ist immer wieder gesagt worden, aber die Situation hat sich jedoch grundlegend geändert. Früher war Deutschland unter dem amerikanischen Schutzschirm gut abgesichert. Doch heute könnte diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet sein. Das bedeutet, um es drastisch zu formulieren: Deutschland könnte nuklear blank dastehen. Und das ist eben auch für Frankreich eine fundamentale Änderung seiner strategischen Lage. Denn: Kann Frankreich sicher sein, wenn Deutschland es nicht ist?
Noll: Bis zum Ende des Halbjahres wolle man nun Gespräche auf der technischen und politischen Ebene führen, sagte Emmanuel Macron neulich in Brüssel. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Lübkemeier: Ein gemeinsames Gremium könnte geschaffen werden, das prüft, wie der Abschreckungsschutz der Force de frappe auf Deutschland ausgeweitet werden kann und wie dies praktisch umgesetzt werden könnte. Doch damit wäre der Prozess nicht abgeschlossen. Eine solche Ausweitung müsste durch eine sichtbare und erkennbare Annäherung Deutschlands an die französischen Nuklearstreitkräfte und die französische nukleare Doktrin untermauert werden. Dies könnte geschehen, indem das Gremium konkrete Schritte entwickelt, die deutlich machen: Wir meinen es ernst mit der Klarstellung im Aachener Vertrag. Zu diesen Schritten könnte beispielsweise die temporäre Verlegung von Flugzeugen mit atomar bestückten Raketen gehören. Auch könnte es eine ähnliche Maßnahme sein wie vor gut zwei Jahren, als sich italienische Luftstreitkräfte an einer Übung der französischen Nuklearstreitkräfte beteiligten – allerdings mit konventionellen Systemen. So was könnte auch zwischen Deutschland und Frankreich eingerichtet werden. Man könnte vielleicht auch sagen, alles ist auf dem Tisch, und darüber sprechen. Der inzwischen verstorbene Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat übrigens mehrfach angeregt, dass Deutschland sich an der Finanzierung der französischen Nuklearstreitkräfte beteiligen könnte. Wenn nicht direkt, dann vielleicht indirekt.
Noll: Lassen Sie uns zum Schluss noch über Geld sprechen. In Deutschland investieren wir derzeit erheblich, um die Luftwaffenbasis in Büchel, Rheinland-Pfalz, so auszurüsten, dass dort bald die US-amerikanischen F-35-Kampfjets mit neuen Atomwaffen stationiert werden können. War das eine voreilige Entscheidung des noch amtierenden Bundeskanzlers, vor dem Hintergrund unserer Annäherung an Frankreich? Wäre es nicht sinnvoller, Büchel stattdessen für die französischen Rafales fit zu machen?

Lübkemeier: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das war keine voreilige Entscheidung. Ich würde sagen, dass solange es möglich ist, sollten wir alles dafür tun, was von unserer Seite möglich ist, den amerikanischen Schutzschirm zu erhalten – selbst wenn man versucht, eine nähere Anbindung an den französischen Schutzschirm zu bekommen. Ich bin dafür, dass das zunächst einmal als eine Rückversicherung Deutschlands geschaffen wird für den Fall, dass die Verlässlichkeit des amerikanischen nuklearen Beistandsversprechens weiter erodiert. Natürlich ist das ein Dilemma. Aber wir sollten nicht dazu beitragen, diejenigen in Washington zu bestärken, die das möglicherweise ohnehin planen oder vorhaben. Das ist eine Gratwanderung. Aber dafür ist Politik da.
Noll: Herr Lübkemeier, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dieses Gespräch ist eine gekürzte Fassung des Franko-viel-Podcastes „#76 – Macron, Merz und die Bombe: Braucht Deutschland die Force de frappe? – Franko-viel – Der Frankreich-Podcast“ vom 13. März 2025.
Über den Autor
Eckhard Lübkemeier ist ehemaliger deutscher Botschafter. Der Politikwissenschaftler ist Gastwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Dort ist unter anderem von ihm erschienen: „Die Vermessung europäischer Souveränität. Analyse und Agenda“, SWP-Studie 24/05: https://www.swp-berlin.org/10.18449/2024S05/ .

In Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds.


