Vertrag von Nancy:
Eine verpasste Chance?


Der am 9. Mai in Nancy unterzeichnete polnisch-französische Freundschaftsvertrag setzt einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Beziehungen beider Länder. Zwischen europäischem Erbe und geopolitischen Realitäten weckt der Vertrag ebenso viele Hoffnungen wie Zweifel.
Der seit mehreren Jahren angekündigte „Vertrag über eine verstärkte Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen der Republik Polen und der Französischen Republik“ wurde am Europatag in Nancy von Premierminister Donald Tusk und Staatspräsident Emmanuel Macron unterzeichnet. Die frühere Residenzstadt von Stanislas Leszczyński – König von Polen (1704–1709 und 1733–1736) sowie Herzog von Lothringen und Bar (1737–1766) – bot dafür einen ebenso symbolträchtigen wie prunkvollen Rahmen. Der Vertrag ergänzt das französische „Netzwerk“ zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen mit den anderen „Großen“ der EU – Deutschland (Aachen, 22. Januar 2019), Italien (Quirinal, 26. November 2021) und Spanien (Barcelona, 19. Januar 2023). Er zieht Konsequenzen aus der geopolitischen Entwicklung seit dem EU-Beitritt Polens im Jahr 2004 und ersetzt das Abkommen vom 9. April 1991, das kurz nach der deutschen Wiedervereinigung geschlossen wurde.
Eine „Nachahmung“ des deutsch-französischen Modells?
Das Instrumentarium von Nancy umfasst 19 „verzweigte“ Artikel und vermittelt den Eindruck eines diplomatischen Nachholversuchs. So die Einschätzung des polnischen Botschafters in Deutschland, Jan Tombiński, für den das französisch-polnische Abkommen ein „Spiegelbild” der deutsch-französischen Verträge von 1963 (Élysée) und 2019 (Aachen) sein sollte…
Zur Erinnerung: Der Vertrag von Aachen stellt einen bedeutenden Fortschritt der deutsch-französischen Beziehungen dar. Er ist in sieben Kapitel gegliedert und legt die Leitlinien fest, nach denen die zwei Staaten ihr „Tandem“ in Europa und darüber hinaus gestalten wollen. Der Vertrag von Aachen hätte in seiner Prägnanz als Beispiel für den Vertrag von Nancy dienen können – das war jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Der Text listet eine so breite Themenpalette auf, dass von Anfang an Zweifel an seiner Umsetzbarkeit aufkommen.
Der Vertrag von Nancy knüpft an etablierte Verfahren der deutsch-französischen Zusammenarbeit an und sieht die Schaffung mehrerer Konsultationsmechanismen vor: einen jährlichen bilateralen Gipfel, Treffen der Außenminister sowie weitere Formate auf Regierungs- und Verwaltungsebene (Art. 1). Die Einrichtung einer französisch-polnischen Parlamentarischen Versammlung nach dem Vorbild der DFPV (Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung) ist hingegen nicht vorgesehen – obwohl in einer Randbemerkung die parlamentarische Diplomatie erwähnt wird. Eine solche Initiative fiele im Übrigen ohnehin in die Zuständigkeit des Sejm und der Assemblée nationale, im Einklang mit dem Prinzip der Gewaltenteilung.
Strategische Ambiguität?
Während Emmanuel Macron wiederholt seine Zweifel an der Belastbarkeit der transatlantischen Allianz geäußert hat, wird die NATO im Vertrag mehrfach genannt – ein Hinweis auf Polens starkes Festhalten am amerikanischen „Schutzschirm“, trotz Donald Trump. Auch bei der klar europafreundlichen Haltung der Bürgerplattform (PO) scheint Warschau also kaum an einer „europäischen Souveränität“ interessiert, die auf politischer Autonomie und strategischer Eigenständigkeit gegenüber den USA beruht. Zwar heißt es in Artikel 2.4, die Vertragsparteien wollten „aktiv an einer stärkeren, sicheren und souveränen EU mitwirken“, aber der Begriff „europäische Souveränität“ fehlt im Vertragstext. In jedem Fall hat die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit als Ziel, die „europäische Säule“ der NATO zu stärken – aber nicht, ein integriertes Sicherheitssystem unter den Mitgliedstaaten der EU aufzubauen.
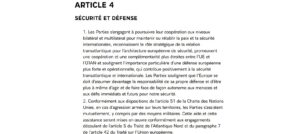
Mit der Überschrift „Sicherheit und Verteidigung“ greift Artikel 4 lediglich bestehende Verpflichtungen innerhalb der NATO und der EU auf – ohne nennenswerten französisch-polnischen Mehrwert. Frankreichs „vitale Interessen“ sind durch seine nukleare Abschreckung abgedeckt; ihre Einsatzdoktrin bleibt allerdings vage und sieht keine ausdrückliche Schutzgarantie anderer europäischer Staaten vor. Zwar könnte Polen theoretisch nuklearbewaffnete Rafale-Flugzeuge stationieren, doch ein solcher Schritt bedürfte umfassender Verhandlungen (bei denen Deutschland unverzichtbar wäre).
Im Rüstungsbereich bleiben auch die industriellen und technischen Aspekte von künftigen Vereinbarungen abhängig, ohne Verpflichtung für eine „europäische Präferenz“ (wofür die Kommission zuständig wäre). Die Probleme, die auf deutsch-französischer Ebene, etwa beim Main Ground Combat System aufgetreten sind, lassen die Herausforderungen eines französisch-polnischen oder gar multilateralen Programms erahnen.
Eine wirtschaftliche „Partnerschaft“?
Polen hatte 2024 „versprochen“ dem Euroraum beizutreten, aber diese Perspektive wird im Vertrag mit keinem Wort erwähnt. Ein französische „Patenschaft“ für die Umstellung vom Złoty auf den Euro hätte dazu beitragen können, gemeinsam für eine Reform der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) einzutreten – etwa im Hinblick auf die Aufgaben und die Governance der Europäischen Zentralbank (EZB). Ebenso zählt die Angleichung der Haushaltspolitiken und der nationalen Positionen zur Finanzierung der EU zu den im Text „vergessenen“ Prioritäten – eine bewusste Entscheidung, um Deutschland und die sogenannten „Sparsamen“ nicht zu verschrecken?
Die fragile französische Nuklearindustrie begrüßt die Absicht Polens, diese Technologie zur Dekarbonisierung seiner Wirtschaft und zur Sicherung seiner Stromversorgung einzusetzen, insbesondere durch die Reduzierung der Kohle als Energiequelle. Unter dem Titel „Energie und zivile Nuklearzusammenarbeit“ drückt Artikel 9 eine gemeinsame Ambition aus: den Bau neuer Kernkraftwerke, sei es in Form leistungsstarker Reaktoren oder kleiner modularer Reaktoren. Ohne dies offen auszusprechen, hoffen beide Länder vermutlich auf eine Kurskorrektur in Berlin – bis dato hält Deutschland weiterhin an seiner Anti-Atom-Position fest, auch wenn Kanzler Friedrich Merz zuletzt Andeutungen eines Umdenkens gemacht hat. Sie bekräftigen ihre Gesprächsbereitschaft in Anerkennung der Freiheit der Mitgliedstaaten, ihren Energiemix selbst zu bestimmen. Sie verpflichten sich zugleich, die Ziele des Pariser Abkommens (2015) einzuhalten und zur Energiehoheit Europas beizutragen.
Mehrere Bestimmungen des Vertrags von Nancy widmen sich wirtschaftlichen Fragen, so z.B. Artikel 6, über die wirtschaftliche, industrielle und digitale Zusammenarbeit. Das Spektrum der möglichen Kooperationen reicht von Verkehr (Art. 8) über Umweltschutz (Art. 7) und Landwirtschaft (Art. 10) bis hin zur wissenschaftlichen Forschung (Art. 11). Eine solche Aufzählung würde auch zur Syldavien passen (Tim und Struppi in Syldavien, 1938)!
Ein besonderer Tag?
Die Wahl des 20. April als „Tag der polnisch-französischen Freundschaft“ (Art. 15) könnte auf einige Skepsis stoßen. Zwar erinnert dieses Datum an die Überführung des Leichnams von Marie Skłodowska-Curie ins Pantheon (1995), doch ist es ebenso der Geburtstag… von Adolf Hitler. Anstelle dieses „Fauxpas“ hätte etwa der 22. Juli eine deutlich stärkere symbolische Bedeutung entfalten können – an diesem Tag hat Napoleon I. 1807 das Herzogtum Warschau ausgerufen und somit die Unabhängigkeit Polens wiederhergestellt. Wird der künftige Präsident Karol Nawrocki, der sein Amt im August antreten wird, das Gesetz zur Ratifizierung des Vertrags unterzeichnen? Warten wir ab.


