Aufklärung als Pflicht: „Mein Kampf“ im Spiegel historischer Kritik
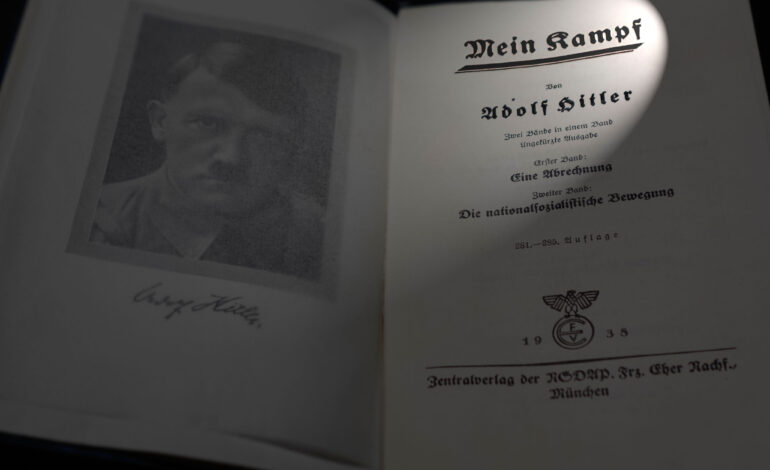
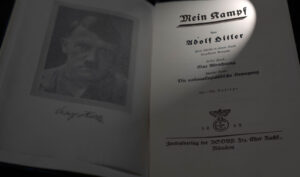
„Mein Kampf“ ist mehr als nur ein historisches Dokument – es ist ein Manifest, das die Grundlage für eines der zerstörerischsten Regime des 20. Jahrhunderts legte. Florend Brayard und sein Team haben es historisch entschlüsselt.
Die Urheberrechte Adolf Hitlers wurden nach dem Krieg zusammen mit seinem gesamten Vermögen von den Alliierten beschlagnahmt und gingen erst Anfang der 1960er Jahre an das bayerische Finanzministerium über. Dieses wollte einer kommerziellen oder ideologischen Verwertung des Buches Mein Kampf durch ein generelles Neuauflagenverbot entgegenwirken. In den siebzig Jahren nach Hitlers Tod wurde das Werk daher nicht erneut gedruckt, von dem zu Hitlers Lebzeiten mehr als 12 Millionen Exemplare verteilt worden waren. Viele davon überlebten in Familienbibliotheken den Zusammenbruch der Naziherrschaft und schon bald wurde ihr Verkauf im Antiquariat wieder gestattet. Mit dem Aufkommen des Internets gab es das Buch dann auch online. Mein Kampf ist deshalb seit einem Jahrhundert fester Bestandteil unserer materiellen und nun auch digitalen Welt und daraus nicht mehr wegzudenken.
Die wichtigste Quelle fehlt
Ein Bereich war von diesem Verbot jedoch in besonderem Maße betroffen: die historische Forschung. Eine zentrale Aufgabe der Geschichtswissenschaft besteht darin, der Öffentlichkeit Quellen zugänglich zu machen – in der spezifischen und kodifizierten Form kritischer Editionen –, die für das Verständnis der Vergangenheit unerlässlich sind. Hitler hinterließ eine Vielzahl posthum veröffentlichter Dokumente, oft in monumentaler Form, die seine zentrale Rolle in der neueren Geschichte unterstreichen. Ein Beispiel: Zwischen 1991 und 2000 veröffentlichte das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München eine Edition seiner Reden, Schriften und Befehle aus den Jahren 1925 bis 1933 – insgesamt 17 Bände mit jeweils mehreren Hundert Seiten. Im Laufe der Zeit wurde nahezu alles publiziert, was sich aus seiner Hand erhalten hatte – bis hin zu Postkarten, die er als junger Mann aus Wien verschickt hatte. Alles – mit einer Ausnahme: Mein Kampf, die wohl bedeutendste Quelle, die im Zentrum der IfZ-Reihe hätte stehen müssen.
Deutsch-französische Zusammenarbeit
Nur zwei Historiker widersetzten sich dem Verbot und veröffentlichten bereits 1994 eine eigene, wenn auch unvollständige, kritische Ausgabe von Mein Kampf. Moshe Zimmermann und Oded Heilbronner verfügten dabei über eine unbestreitbare Legitimität: Ihre Edition erschien auf Hebräisch im Universitätsverlag Akademon in Jerusalem. Eine juristische Verfolgung wegen der Verletzung von Hitlers Urheberrechten wäre nicht nur aussichtslos, sondern auch moralisch kaum vertretbar gewesen. Ihre Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen oder den Niederlanden – um nur die Länder zu nennen, in denen in den letzten Jahren kritische Ausgaben erschienen – mussten hingegen geduldig warten, bis das Urheberrecht abgelaufen war. Das geschah am 1. Januar 2016. Von diesem Zeitpunkt an war es jedem möglich, eine eigene Ausgabe herauszugeben, ohne den Zorn des bayerischen Finanzministeriums befürchten zu müssen.

Bereits vor Ablauf der Urheberrechtsfrist begannen zwei Teams mit der Vorbereitung einer kritischen Ausgabe: das IfZ in München und die Éditions Fayard in Paris. Die deutsche Ausgabe – Hitler. Mein Kampf. Eine kritische Edition – erschien im Januar 2016 als erste. Ihre Veröffentlichung sorgte für erhebliches mediales Aufsehen, was im Rückblick kaum überrascht – aus zwei Gründen: Zum einen handelte es sich um die erste deutschsprachige Neuausgabe seit dem Zweiten Weltkrieg, zum anderen um die weltweit erste vollständige kritische Edition des Werks. Die Ausgabe umfasste zwei großformatige Bände und setzte neue Maßstäbe.
Auf französischer Seite konnten wir – das neue Team bei Fayard unter meiner Leitung – unmöglich so tun, als ließe sich das Projekt völlig unabhängig von der deutschen Ausgabe entwickeln. Umso größer war unsere Erleichterung, als Andreas Wirsching, der Direktor des IfZ sich ich bereit erklärte, dass wir seinen kritischen Apparat für die französische Ausgabe anzupassen.
3000 Anmerkungen
Der kritische Apparat besticht durch strahlende Gelehrsamkeit und makellose Präzision. Das deutsche Team unter der Leitung von Christian Hartmann war unter anderem bemüht, Hitlers ideologische und literarische Inspirationsquellen ausfindig zu machen – ein Unterfangen, das sich als schwierig erwies, da Hitler sich selbst als originären Denker ohne direkte Vorläufer betrachtete. Besonders eindrucksvoll ist jedoch die Arbeit der Kontextualisierung: Hitler reagierte beim Schreiben häufig auf aktuelle Ereignisse – auf zahllose große und kleine Vorkommnisse, die für seine Zeitgenossen unmittelbar verständlich waren. Ein Jahrhundert später ist diese Aktualität nicht mehr gegeben. Hitler bezog sich explizit oder implizit auf Referenzen, Konzepte, Überzeugungen, Denkhaltungen und gesellschaftliche Reflexe, die für uns größtenteils wirkungslos geworden sind.
Durch die Bereitstellung historischer Hintergrundinformationen ermöglichten die deutschen Historiker es dem heutigen Publikum, das Buch überhaupt erst im Kontext seiner Zeit zu verstehen. Wir haben diesen umfassenden Apparat für das französische Publikum übernommen und dabei behutsam angepasst – stets mit dem Ziel, so präzise wie möglich, aber auch so knapp wie nötig zu bleiben. Trotzdem umfasst der Anmerkungsteil weiterhin fast dreitausend Einträge, deren Gesamtlänge etwa der des Originaltexts entspricht.
Tausende von Stunden
Das zehnköpfige Team von Historikern und Germanisten, das mit der Arbeit an Historiciser le mal betraut war, konnte sich auf die Arbeit seiner Münchner Kollegen stützen. Dennoch stellte sich bei der Erarbeitung der französischen kritischen Ausgabe von Mein Kampf eine Reihe zusätzlicher Herausforderungen – allen voran die Übersetzung. Wir entwickelten ein Modell für die Übertragung von Hitlers Sprache ins Französische, das dem Übersetzer Olivier Mannoni als Grundlage diente. Anschließend überprüften wir seinen ersten Entwurf und verbrachten Tausende von Stunden mit der Überarbeitung der zweiten Fassung. Zudem wollten wir unsere Leser intensiver begleiten als unsere deutschen Kollegen. Deshalb verfassten wir zusätzlich zu ihrer allgemeinen Einführung für jedes der 28 Kapitel eine spezifische Einleitung. Diese Kapiteleinführungen sind ebenso umfangreich wie der Originaltext und bieten tiefgehende Analysen, die es den Lesern ermöglichen, Hitlers Fallstricke zu erkennen und sein erschütterndes Erbe besser zu verstehen.
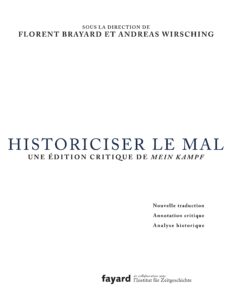
In diesem Punkt weichen die verschiedenen kritischen Ausgaben von Mein Kampf eindeutig vom klassischen Modell der Quellenedition ab: Wir konnten uns nicht damit begnügen, die Vergangenheit und Gegenwart des Buches nur zu dokumentieren, wie es üblich ist, sondern mussten uns auch um seine Zukunft kümmern. Das bedeutet, dass wir die tragischen Folgen der darin vertretenen Ideologie für ganz Europa so präzise wie möglich beschreiben mussten. Mein Kampf mag keine direkte Anleitung für die Zeit nach der Machtübernahme bieten, doch es schildert detailliert zahlreiche Grundzüge der späteren Nazi-Politik: die Abschaffung des Parlamentarismus, die Zerschlagung politischer Parteien und die Auflösung der Gewerkschaften, die Rassengesetzgebung und Verfolgung von Juden sowie anderen Minderheiten, eine revisionistische und expansionistische Außenpolitik, die zwangsläufig zu einem neuen Weltkrieg führen musste. Jede der kritischen Ausgaben dient daher auf ihre Weise auch als Mahnmal für die Millionen von Opfern des Nationalsozialismus.
Die brandgefährliche Natur dieser Ideologie wird exemplarisch veranschaulicht, sodass Historiciser le mal, wie auch die anderen europäischen Editionen, ein klares politisches oder staatsbürgerliches Ziel verfolgt: Weit davon entfernt, sich in einer axiologischen Neutralität zu gefallen, ergreift das Werk Partei. Besonders deutlich wird diese Haltung bei der Entlarvung der Lügen und Halbwahrheiten, die Hitler während seiner Karriere verbreitete. Nicht nachlassen in der Aufdeckung politischer Lügen mit allzu katastrophalen Folgen: Das ist ein Kampf, der in unserer vom Populismus geprägten Zeit leider immer noch hochaktuell ist.
Der Autor

Florent Brayard ist Forschungsdirektor am Centre National de Recherche Scientifique in Paris. Er ist Historiker und hat sich mit der Geschichte der Holocaustleugnung und dann mit der Geschichte des Holocaust befasst. Er ist Autor mehrerer Monographien, darunter die „‚La Solution finale de la question juive‘. La technique, le temps et les catégories de la décision“ (Fayard, Paris 2004); „Auschwitz, enquête sur un complot nazi“ (Le Seuil, Paris 2012). Im Jahr 2021 veröffentlichte er zusammen mit Andreas Wirsching: „Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf“ (avec Andreas Wirsching, Fayard).


